 Menschen, die über Comics schreiben und sich Kritiker oder Rezensenten nennen, sind per definitionem an Comics interessiert. Sie kaufen neue Comics, bekommen selbige auch von Verlagen zugeschickt, um über Dialoge zu reflektieren, um die Konstruktion von Charakteren zu bewerten und um gelungene oder misslungene grafische Darstellung zu beurteilen. Sprich, sie schreiben eine möglichst umfassende Beurteilung über ein Stück Populärkultur. Dabei machen sie sich soviel Gedanken über den Comic, über die Arbeit eines anderen, dass eine Reflexion über ihre eigene Arbeit zu oft ausbliebt.
Menschen, die über Comics schreiben und sich Kritiker oder Rezensenten nennen, sind per definitionem an Comics interessiert. Sie kaufen neue Comics, bekommen selbige auch von Verlagen zugeschickt, um über Dialoge zu reflektieren, um die Konstruktion von Charakteren zu bewerten und um gelungene oder misslungene grafische Darstellung zu beurteilen. Sprich, sie schreiben eine möglichst umfassende Beurteilung über ein Stück Populärkultur. Dabei machen sie sich soviel Gedanken über den Comic, über die Arbeit eines anderen, dass eine Reflexion über ihre eigene Arbeit zu oft ausbliebt.Aus unterschiedlichen Anlässen hat seit einigen Monaten ein Diskurs zu diesem Thema mit meinen Kollegen bei Comicgate stattgefunden. Intern wurden Positionen erläutert, Fragen wurden gestellt und Beispiele diskutiert. Die Frage die steht im Zentrum stand: Was macht eine gute Rezension aus? Welche Formel ist zu beachten und macht die Benutzung einer Formel, die Anwesenheit eines Rezensenten nicht gleich obsolet. Dann könnte man den entsprechenden Comic in eine Bewertungsmaschine stecken, die gewünschte Note ausspuckt. Obwohl die Redaktion von Comicgate sich einig ist, dass das Schreiben einer Rezension ein Prozess ist, der ganz unabhängig von der Bewertung des Comics unendlich verschiedene Ansätze bietet, geht die Reflexion erfreulicherweise weiter. Da viele der besprochenen Aspekte auch für die aktuelle Diskussion der deutsche Comickritik wertvoll sind, möchte ich an dieser Stelle unsere Erkenntnisse zusammenfassen und in die laufende Kritik einführen:
Im Idealfall sind Comicrezensenten informierte Beobachter, die Hintergründe des Comics kennen, eine objektive Bewertung von Story und Zeichnungen abgeben können und dazu noch das gesamte Paket in eine lesbare Formen bringen, die auch noch Raum für subjektive Sichtweisen zulässt. Sie arbeiten als Vorhut, die allen nachfolgenden Leser auf das Kommende vorbereitet und mögliche Ratschläge gibt, ohne zu beeinflussen.
Aber springen wir kurz einmal in die aktuelle Debatte hinein. Mein werter Kollege Marc-Oliver Frisch hat in unsere Diskussion nun auch die Big Guns rausgeholt. Denn auch in der Welt der Blogs wird die Frage, wie Kritiken aussehen können, mannigfaltig diskutiert. Marc-Oliver hat dabei einen extremen weiten Blick über den großen Teich geworfen und zwei schöne Beispiele gefunden: Zum einen ein Interview von Noah Berlastky mit Daphne Carr, Herausgeberin der Serie Best Music Writing und zum anderen eine Einschätzung von Filmtheorielegende David Borwell.
Eine kleine Beurteilung meinerseits zu Marc-Olivers schönen Links und der Frage ob Kritiken medienübergreifend anzugehen sind, soll hier folgen: Beginnen wir mit den Bemerkungen von Frau Carr: Natürlich ist die Herangehensweise der Verlegerin zunächst unglaublich verlockend. Sie spricht davon, dass ihr Best Music Writing nicht unbedingt eine Aufsatzsammlung, sondern eher eine Ansammlung von neuen Ansätze darstellt, ein Fundus an neuen Möglichkeiten über Musik zu schreiben. Noch bevor Frau Carr weiter darauf eingeht und Beispiele bringt, beginnt der Vergleich zu Comickritiken zu hinken.
Obwohl Comics bereits seit über hundert Jahren in unserer Kultur angekommen sind, hat sich die Betrachtungsweise von Comics noch immer nicht etabliert. Vergleicht man aktuelle Rezensionen über Comics mit Texten über Musik, so wird deutlich, dass Comickritiken sich noch nicht weit genug vom Formelhaften gelöst haben. Ist eine Kritik, die ausschließlich über die psychologischen Auswirkungen der Farbwahl in einem Mattotti-Comic, wirklich möglich? Könnte die Besprechung von Sfars Die Katze des Rabbiners eine Lobeshymne aufs Leben sein, wie Lester Bangs Essay über van Morrisons Album Astrals Weeks? Mein Problem mit Carrs Ansatz im Bezug auf Comics lässt sich am besten mit den Worten eines Musikers zusammenfassen, mit den Worten von Elvis Costello:
„Writing about music is like dancing about architecture – it’s a really stupid thing to want to do.“
Auch wenn engagierte Besprechungen im Feuilleton und Dialogrezensionen und gezeichnete Kritiken bei Comicgate einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, konnten Comics leider immer noch nicht die Tanzfläche erobern.
Nachvollziehbarer und besser an Comics anpassbarer finde ich hingegen die Einschätzungen von David Bordwell, den ich bereits während meines Studiums der Amerikanistik schätzen lernen musste (mein Dozent hat sich unsterblich in ihr wegweisendes Buch Film Art: An Introduction verliebt und auch ich habe mich daran sehr erfreut). Wahrscheinlich liegt es an der visuellen Natur der Comics, die sie mit ihrer Stiefschwester, dem Film, verbindet. Es eröffnet die Möglichkeit sich an formellen Strukturen festzuhalten, doch gleichzeitig besteht auch die Gefahr sich daran festzuklammern, oder wie Carr so treffend „writing that recreates either press releases or preexisting reviews“ anklagte.
Von der Besprechung der mise-en-scéne, der Montage und den Figuren kann sich der Filmkritiker lösen, um dann eben die philosophischen und gesellschaftlichen Fragen zu lösen, die Carr so gerne durch die Essays über Musik beantwortet sieht. So kann der Kritiker seine Stellung als imformierte Vorhut vor den Lesern rechtfertigen, seine Bewertung des Comics immer wieder durch Argumente belegen und seine subjektive Meinung einfließen lassen.
Somit ist auch der beste Ratschlag von Bordwell folgender:
„Opinions need balancing with information and ideas. The best critics wear their knowledge lightly, but it’s there. To be able to compare films delicately, to trace their historical antecedents, to explain the creative craft of cinema to non-specialists: the critical essay is an ideal vehicle for such information. The critic is, in this respect, a teacher.“
Abschließend sei gesagt, dass es keine perfekte Comicrezension gibt. Aus diesem Grund ist auch das gesamt Spektrum an Besprechungen wünschenswert; Sowohl formelhafte Kritiken, als auch fabulierende Essays müssen geschrieben werden. Eine freundliches Kritik zu Brian Lee O’Malleys Scott Pilgrim hat ihren Platz genauso verdient, wie ein manieristisches Loblied auf die Verbindung aus manga und westlicher Popkultur.
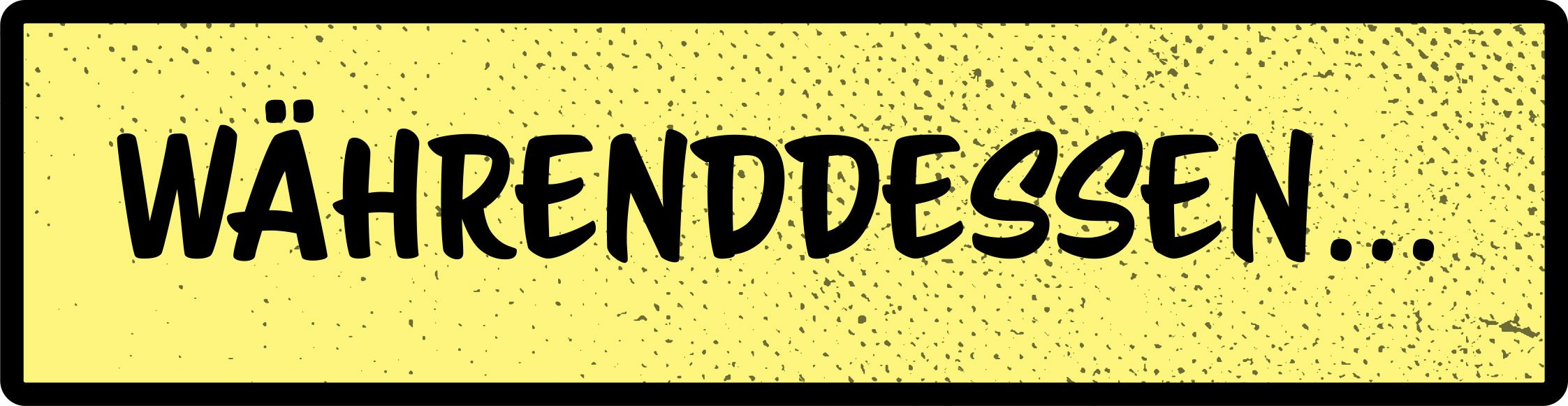
 waehrenddessen.de
waehrenddessen.de