Nie hätte ich mir träumen lassen, das zu sagen, aber wenn ich einmal alt bin, wäre ich gerne so wie Jeff Daniels. Nicht der kindische Jeff Daniels, der in Dumm und Dümmer auf einem Miniaturmotorad hinter Jim Carrey sitzt, sondern der kindische Jeff Daniels, der auf einem viel zu kleinen Fahrrad in Paper Man herumfährt. Ein erwachsenes Kind, das sich die Welt in Butter gehüllt vorstellt.
Vor lauter Butter trieft der Hummer, den der Schriftsteller Richard Dunn alias Jeff Daniel mit seiner Frau Claire (Lisa Kudrow) verspeist. Um seinen lang erwarteten zweiten Roman zu schreiben, hat sich Richard aufs Land zurückgezogen. Während seine Frau, die erfolgreiche Ärztin, ihn in Ruhe arbeiten lässt, bleibt Richard als Gesprächspartner nur sein eingebildeter Freund aus Kindertagen, Captain Excellent (Ryan Reynolds), den er nie ganz losgelassen hat.
Zum Glück verschwindet Reynolds nach kurzen carreysken Punchlines stets wieder im Wandschrank oder im Wasser, sodass seine Auftritte nur amüsante Fußnoten zu seiner Rolle als Green Latern sind. Die eigentliche Heldin ist Abby, gespielt von der bezaubernden Emma Stone, die schon in Einfach zu haben ihren rauen Charme zur Schau stellte. Richard trifft sie als er seine Einsamkeit nicht mehr aushält:
Richard regarded his solitude as unbereable.
Als die Welten von Richard und Abby sich berühren, entsteht die Reibung, die den Film vom Blödelkomödienimage befreit, das ihm der Trailer verpasst hat:
Zwei kaputte Menschen treffen aufeinander. Mit Stone hat Daniels endlich ein (Film-)partner gefunden, der ihn kompletiert, der das Beste in ihm herausbringt. Die Unterhaltungen gehen zunächst nicht in die Tiefe, doch gerade diese verständliche Oberfläche der Konversation liegt beiden und scheitert erst dann kläglich als Richard selbige Dialoge generationsübergreifend an seiner Frau testet. Beiden Protagonisten sinnieren über die Vergangenheit und müssen einsehen, dass ihr missratenes Leben eigentlich nicht so schlecht ist. Paper Man könnte als typischer Coming-of-Age Film abgehakt werden.
Doch ist es gerade die Entfaltung der wundervollen Dialoge und das entsprechende Timing, die Paper Man zu einem wirklich guten Film machen, der sein oft so moralisierendes Genre wiederbelebt. Gespräche über Handseife als Fahrradöl und über selbstgemachten Suppen verleihen dem Genre eine verlorengeglaubte Authentizität. Die Pointen sitzen fast schon zu gut, sodass unbeantwortete Fragen stutzig machen, vor allem dann, wenn sie Minuten später doch beantwortet werden. Und so fragt man sich bei jeder kleinen Anspielung, handelt es sich dabei um eine Allegorie aufs Leben oder wird hier nur rumgeblödelt. Das Schöne an Paper Man – beides passiert gleichzeitig:
„Does this couch make me look fat?“
„I wouldn’t sit there.“
Doppeldeutige Wortspiele über Flundern (im Englischen „that’s a fluke“ „In which sense?„) werden zu philosophischen Auseinandersetzungen. Nach einigen Minuten dieses beeindruckenden Wortduells zwischen Daniels und Stone wird sogar die Abwesenheit ihrer Gesprächen zu einem Stilmittel, dem man gerne zuhört. Die Pausen werden zum essentiellen Teil des Dialogs.
Am Ende muss der Film natürlich seinem Genre treu bleiben. Es ist höchste Zeit erwachsen zu werden, wenn selbst Lisa Kudrow das Lachen vergeht und zu Weinen beginnt. Doch die Dialoge bleiben in Erinnerung: Paper Man beschreibt eine Welt, in der einfache Worte wie „Freundschaft“ und „Lachen“ eine Renaissance erleben. Dabei erzeugen sie ein Momentum, das jeden Dialog augenblicklich ohne jeden weiteren Gesprächsbedarf beendet.
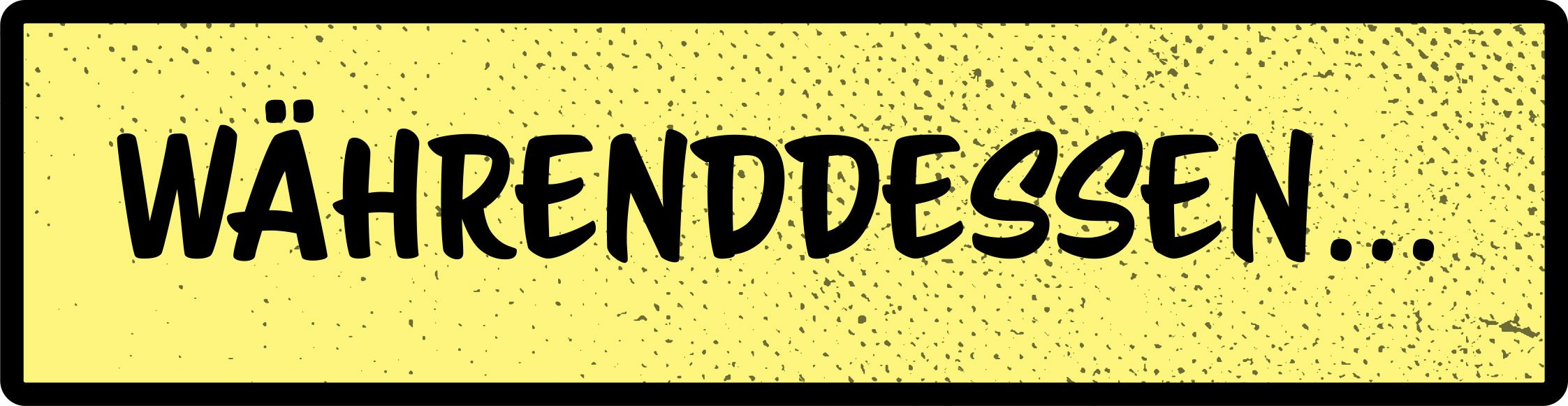
 waehrenddessen.de
waehrenddessen.de